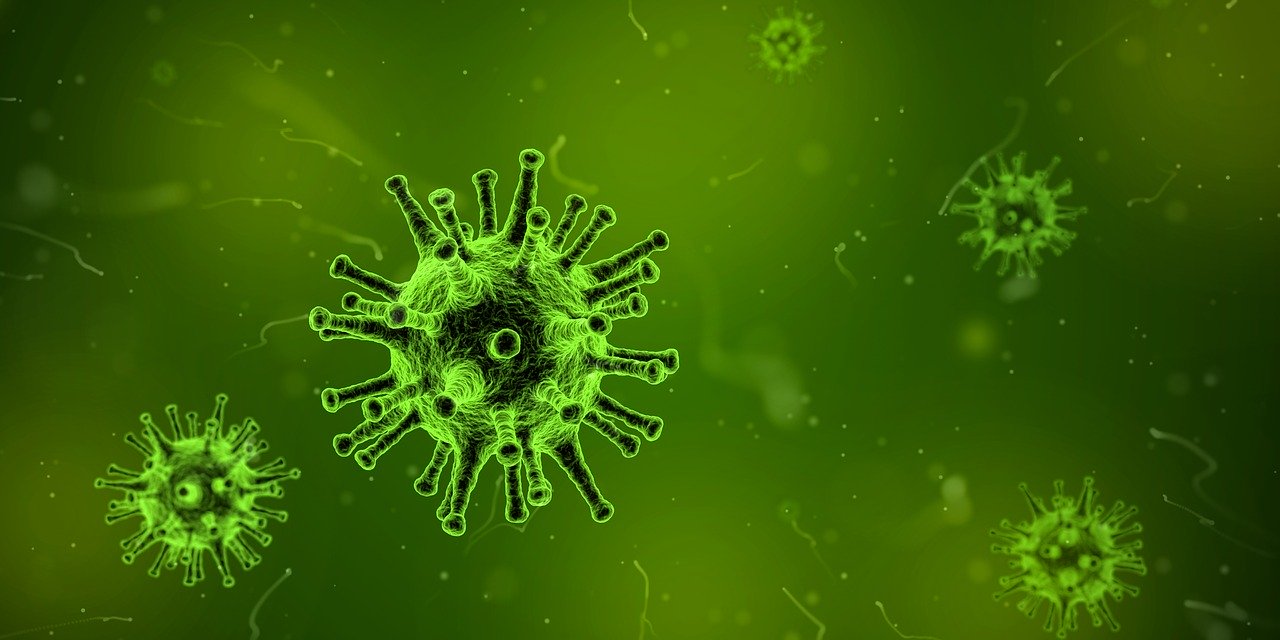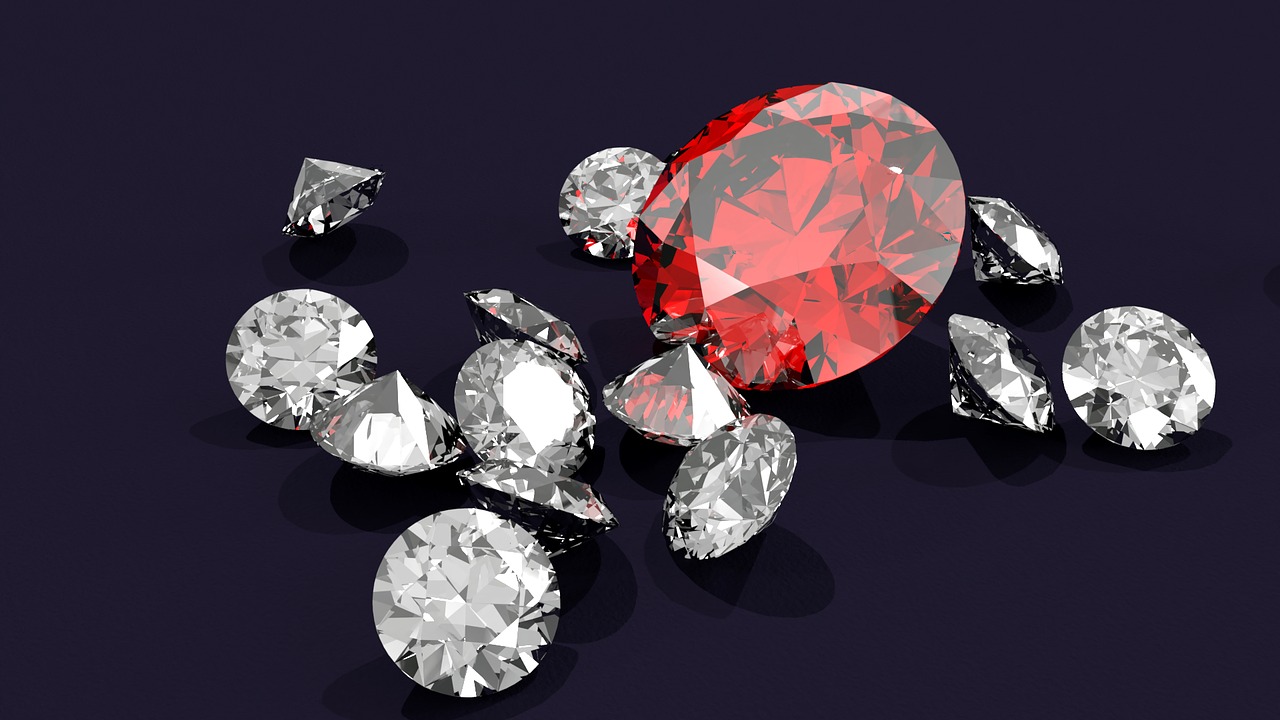Cottbus| Der UVBB und der Arbeitgeberverband Lebuser Land (OPZL) haben am 25. und 26. Januar auf der Messe Handwerker 2020 in Cottbus ihr gemeinsames Projekt „Gelebte Nachbarschaft in der Euroregion Spree-Neiße-Bober 2020“ vorgestellt. Mit 285 Ausstellern lockte die Messe Tausende Besucher in die Cottbuser Messehallen. Insbesondere auch Firmen aus Polen fanden am Wochenende den Weg in die Lausitz. Zum 30. Mal hat die „HandWerker“ indiesem Jahr stattgefunden. Der UVBB hat am 25. Januar ein Arbeitsrechtsseminar angeboten, das Rechtsanwalt Radoslaw Niecko von der MN Legal Rechtsanwaltsgesellschaft Berlin übernommen hat.
Neueste Artikel
Auftragsengpässe durch Corona-Virus: Kurzarbeitergeld grundsätzlich möglich
Das Corona-Virus kann durch Lieferengpässe oder Schutzmaßnahmen bei Betrieben erhebliche Arbeitsausfälle verursachen. Sollten diese Arbeitsausfälle mit einem Entgeltausfall verbunden sein, ist ein Ausgleich mit Hilfe des Kurzarbeitergeldes möglich.
Der Anspruch auf Kurzarbeitergeld muss grundsätzlich auf einem unabwendbaren Ereignis oder wirtschaftlichen Gründen beruhen. Dies trifft etwa dann zu, wenn Lieferungen ausbleiben und die Produktion eingeschränkt werden muss. Ein unabwendbares Ereignis liegt auch dann vor, wenn etwa durch staatliche Schutzmaßnahmen Betriebe geschlossen werden.
Ob die Voraussetzungen für die Gewährung des Kurzarbeitergeldes vorliegen, entscheidet die zuständige Agentur für Arbeit.
Betriebe müssen Kurzarbeit vorher bei der Arbeitsagentur anzeigen.
Wichtig ist, dass Betriebe im Bedarfsfall bei ihrer zuständigen Agentur für Arbeit Kurzarbeit anzeigen.
Die Arbeitsagenturen sind auf solche Situationen gut eingestellt. Arbeitgeber können sich entweder direkt in der Arbeitsagentur oder telefonisch unter 0800 45555 20 informieren.
Informationen über die Voraussetzungen für Kurzarbeitergeld und Videoanleitungen finden sie auf der Seite
https://www.arbeitsagentur.de/unternehmen/finanziell/kurzarbeitergeld-arbeitgeber-unternehmen
Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung – gegen die deutsche Wirtschaft
Monate, und Nächte haben die Mitglieder der Kommission für Wachstum, Strukturwandel und Beschäftigung geopfert, um zu dem Kompromiss für den Kohleausstieg zu kommen. Der BDI selbst hat diesen Kompromiss mit verhandelt. Jetzt stellt sich das Institut für Wirtschaftsforschung gegen diesen Kompromiss und damit auch gegen die Bevölkerung in den „Kohleregionen“ und auch gegen den BDI und erklärt, dass der Kohleausstieg spätestens 2030 erfolgt sein muss.
Die Abgeordneten der Lausitz von CDU und SPD haben mit vielfältigen Initiativen und mit persönlichem Einsatz dafür gerungen die Gesetzesvorlagen für die Umsetzung des Abschlussberichts der Kommission durch das Bundeskabinett zu bringen und ringen derzeit um die Bestätigung der Gesetze im Bundestag.
Geschafft? – weit gefehlt. Das Institut für deutsche Wirtschaftsförderung fällt den Kohleregionen und den dort lebenden Menschen, aber auch insgesamt der deutschen Wirtschaft in den Rücken. 2030 soll / muss das Enddatum sein. Die Wirtschaft wird hier als „Buhmann“ des Klimawandels geopfert.
Ohne gesicherte Energieversorgung kein gesicherter Strom, keine gesicherte Wärmeversorgung in den Großstädten, drastisch schwindende Kaufkraft in den Regionen und damit steigende Insolvenzen im Klein- und Mittelstand (Handwerk, Handel, Dienstleistung, Beauty, Wellness etc.)und anderen Wirtschaftszweigen. Das kann es nicht sein. Aufrechnen von Energie aus fossilen Brennstoffen mit den Errungenschaften des Lebens sind u. E. zu kurz gesprungen.
Betrachten wir die Realitäten des Braunkohleendes. MdB Dr. Klaus Peter Schulze (CDU) hat mehrfach darauf verwiesen, dass eine vorschnelle Beendigung des Kohleabbaus in der Lausitz eine große Gefahr für den Wasserhaushalt der Spree bedeutet und damit auch zu einer Gefahr für das Kleinod „Spreewald“ wird.
Es stehen aber auch noch solche Fragen an wie: Wer baut und auf wessen Kosten die Kraftwerke zurück? Wo sind dafür die Rücklagen. Wie erfolgt deren Entsorgung und wie? Gibt es dazu Vereinbarungen zwischen den Kohleländern, den Energieunternehmen und dem Bund?
Und dann steht noch die Frage im Mittelpunkt wie es und gelingt mindestens 8000 gut bezahlte Industriearbeitsplätze in akzeptablen und alternativen Wirtschaftsbereichen in rund 8 Jahren in der Lausitz zu schaffen, denn dann ist das Kraftwerk Jänschwalde abgeschaltet. Die angekündigten Ansiedlungen im Bereich der BTU und den Industriestandorten Schwarze Pumpe und Schwarzheide sind ein Licht am Horizont, brauchen aber neben dem persönlichen Einsatz aller Bundestagsabgeordneten der Lausitz und der Landesregierungen von Brandenburg und Sachsen Engagement für die Umsetzung und eine konsequente Haltung gegenüber dem Bund für die buchstabengerechte Umsetzung der Gesetze zum Kohleausstieg.
Region erhalten, Arbeitskräfte zu halten, Jugend Zukunft zu geben erfordert mehr als Schlagzeilen. Wir brauchen sichtbare und fühlbare Projekte des Strukturwandels, sogenannte „Ankerprojekte“.
Unternehmerverband Brandenburg-Berlin e.V.
Horst Böschow
Regionalmanager Südbrandenburg
Koordinator des Wirtschaftsverkehrsnetzwerk Lausitz
Logistik in der digitalen Welt
Das war das Thema für einen Vortrag den Herr Alexander Hornung, Regionalleiter Ost der Firma Kühne + Nagel (AG & Co.) KG in Großbeeren, am 11. Februar 2020 im Industriemuseum Teltow im Rahmen einer gemeinsamen Veranstaltung mit dem Unternehmerverband Brandenburg-Berlin gehalten hat.
1890 von August Kühne und Friedrich Nagel in Bremen gegründet, zählt Kühne und Nagel heute mit mehr als 1.300 Niederlassungen in über 100 Ländern und rund 82.000 spezialisierten Mitarbeitern zu den erfolgreichsten Unternehmen der Logistikbranche. Die Kühne + Nagen Gruppe ist weltweit größter Seefrachtspediteur sowie zweitgrößter Luftfracht-Logistikanbieter.
Im europäischen Overland-Sektor zählt Kühne + Nagel zu den 5 führenden Anbietern. Weltweit verfügt das Unternehmen über 10,6 Millionen Quadratmeter eigener Lagerfläche und ist damit die Nummer 2 der Kontraktlogistik. Eigene Schiffe, LKWs oder Flugzeuge betreibt das Unternehmen nicht.
Kühne und Nagel Deutschland beschäftigt rund 15.000 Mitarbeiter, inklusive der rund 4.500 der Kontraktlogistiktochter Stute Logistik, an mehr als 130 Standorten, der Hauptsitz ist in Bremen.
Was treibt die Entwicklung in der Logistikbranche?
Herr Hornung wies darauf hin, das sich in den letzten Jahren eine stürmische Entwicklung hin zu einem Käufermakt vollzogen hat und der Käufer und Endkonsument mittlerweile zum Treiber der Wirtschaft und somit auch der Logistik geworden ist. Endkonsumenten setzen hier Maßstäbe, wie man auch in einer Befragung von Verbrauchern erkennen kann.
Hierbei ging es darum, welche Themen für die Verbraucher wichtig sind:
* Sendungsverfolgung mit 90%
* Lieferzeitfenster und Lieferzeitfristen mit 83%
* Umweltfreundlicher Transport mit 61%
* Extrem kurze Lieferzeiten mit 59%
* Variable Lieferzeitänderungen mit 56%
Diese Anforderungen haben die Logistikbranche zu rasanten Veränderungen gezwungen und u.a. die Digitalisierung und Automatisierung der Prozesse bewirkt.
Die Wege zur Digitalisierung sind:
* Technologische Entwicklungen
* Automatisierung
* Neue digitale Produkte und Lösungen
Damit sollen folgende Ziele erreicht werden:
* Kundenorientierung
* Differenzierung
* Vereinfachung der Zusammenarbeit mit Kunden und Partnern
* Datenverfügbarkeit
Die Digitalsierung bei K + N
Der Einfluss der Digitalisierung zieht sich durch nahezu alle Unternehmensbereiche:
– Planung
– Operations
– Commercial und Support Function
API als Standard- Schnittstelle zwischen K + N und den Partnern gewährleistet automatisierte Prozessabläufe und die Nutzung der Systeme durch die Kunden und Partner.
Big Data
Die Digitalisierung ist verbunden mit einem enormen Anfall von Daten und der Kombination der verschiedensten Daten. Das ist gleichzeitig die Grundlage für vorausschauende Systeme mit der zunehmenden Anwendung der künstlichen Intelligenz.
Big Data bietet die Möglichkeit für:
– Optimierung der Bestände
– Reduzierung von Risiken und
– Kunden sich weiter zu entwickeln
Praktische Demonstration am Beispiel Seefracht
Herr Hornung zeigte die Prozessabläufe in Realzeit auf der digitalen Grundlage am Beispiel der Seefracht. Kühne und Nagel stellt in seinem System permanent folgende aktuelle Daten bereit:
– Daten von 1200 Häfen weltweit
– realistische Laufzeiten
– die aktuelle Position aller Containerschiffe Weltweit
– Die Daten der Containerschiffe inklusive Umweltfaktoren
– Datengesteuerte Erkentnisse für die Planung
– Volle Transparenz im Kunden- Online- Service wie Analysen, Preise, Buchungen, Tracking u.a.
Am Beispiel einer Fracht von Hamburg nach Singapur wurde aus der Sicht eines Kunden ein Vorgang von der Auswahl des Containerschiffes bis zur Übernahme und Realisierung des Auftrages durch Kühne + Nagel in Echtzeit durchgespielt.
Kontaktdaten: alexander.hornung@kuehne-nagel.com
Lothar Starke
Nr. 1/2020 – Mittelstandsfinanzierung: neue Wege – solide Basis
Die 1. Ausgabe des Ostdeutschen Wirtschaftsmagazines NUVO in 2020 zum Fokusthema „Mittelstandsfinanzierung: neue Wege – solide Basis“. Erschienen im Februar 2020.
Diamanten in der Produktion
Das war das Thema für einen Vortrag, den Herr Prof.Dr. Heiner Vollstädt, Inhaber der Firma Vollstädt-Diamant GmbH Seddiner See, am 28. Januar 2020 im Industriemuseum Teltow gehalten hat.
Der Vortrag erfolgte im Rahmen der gemeinsamen Veranstaltungen des Unternehmerverbandes Brandenburg-Berlin e.V. und des Vereins Industriemuseum Region Teltow e.V.
Herr Prof. Dr. Vollstädt behandelte in seinem Vortrag sowohl die Eigenschaften der Diamanten als auch die Gewinnung natürlicher und künstlicher Diamanten sowie die Anwendung als Industriediamanten und als Schmuckdiamanten.
Eigenschaften der Diamanten
Diamant ist ein Mineral der Superlative in vielfacher Hinsicht: hoch begehrt als „König der Edelsteine“, aber auch von außerordentlicher Bedeutung für technische Anwendungen.
Diese Stellung verdankt der Diamant einer Kombination hervorragender Eigenschaften:
- Diamant ist das härteste Mineral, das wir kennen
- Diamant hat eine außergewöhnlich hohe Lichtbrechung
- Diamant hat eine außergewöhnlich hohe Dispersion
- Diamant hat die höchste thermische Leitfähigkeit und die geringste thermische Ausdehnung
- Diamant ist ein ausgezeichneter Isolator
Diamanten kommen in der Natur sehr selten vor, sie sind nur in geringsten Gewichts-und Volumenanteilen im „Wirtsgestein“ vorhanden und müssen mit großem technischem und finanziellem Aufwand extrahiert werden.
Man geht davon aus, dass im Durchschnitt auf 100 t abgebautem Gestein eine Ausbeute von 5cts (=1g) rohem Diamant steht.
Die so gewonnenen Diamanten werden überwiegend zu technischen Zwecken verwendet. Die
Nachfrage kann durch die natürliche Gewinnung nicht gedeckt werden, sodass seit den 1955 er Jahren die kommerzielle Produktion syntheticher Diamanten erfolgt.
Bezogen auf das gesamte Handelsvolumen von Diamanten werden heute ca. 98% von Synthesen
eingenommen, mit starker Steigerung. Ursächlich hierfür ist die enorme Bedeutung und Nachfrage in Technik und Elektronik.
Synthetische Diamanten
Für die kommerzielle Produktion synthetischer Diamanten für technische Zwecke und die Verwendung in der Schmuckbranche werden heute verschiedene Verfahren angewendet. Größte Bedeutung besitzen das HPHT-Verfahren (Hochdruck-Hochtemperatur-Verfahren) und das CVD- Verfahren (Chemical-Vapour Deposition).
Der Herstellungsprozess synthetischer Diamanten unter hohem Druck und hohen Temperaturen leitet sich direkt von den Bildungsbedingungen natürliche Diamanten im oberen Erdmantel ab.
Für das Erreichen dieser extremen Wachstumsbedingungen von P= 5 bis 5,5 Gpa (Gigapascal) und T= 1300 bis 1500 ° C werden hydraulische Pressen verwendet.
Herr Prof.Dr. Vollstädt zeigte in seinem Vortrag die theoretischen Grundlagen der Diamantsynthese und die Verfahren und Einrichtungen der praktischen Herstellung mit weltweiten Beispielen.
Technische Anwendungen des Diamant
– Nutzung der Härte
Fräsen, Bohren, Schneiden, Schleifen im Makro- bis Mikrobereich (von Bohrköpfen für Tunnelbaumaschinen bis zu Mikrobohrern für die Uhrenindustrie, Dental- und Medizintechnik sowie Luft- und Raumfahrtindustrie)
– Nutzung der optischen Transparenz
Transparenz vom Infrarot- bis zum Ultraviolettbereich
(Optische Fenster)
– Nutzung der Wärmeleitfähigkeit
Die Wärmeleitfähigkeit ist um ein mehrfaches größer als Kupfer.
Nutzung z.B. zur Wärmeableitung (Kühlung) in Hochleistungs- Bauelementen der Elektronik.
– Nutzung als elektricher Isolator
In elektronischen Bauelementen , kombinierte Nutzung der Wärmeleitfähigkeit und Isolatoreigenschaft
Kontakt: Prof. Dr. Heiner Vollstädt, info@vollstaedt.com
Lothar Starke
Wird auf den 09.12.20 verschoben: Fachkräftemangel – Thema beim Ostdeutschen Unternehmertag 2020

Potsdam | Die Sorge um Fachkräfte in den Unternehmen wird 2020 ein bestimmendes Thema für den UVBB sein. Beim Ostdeutschen Unternehmertag am 26. März 2020 steht es im Mittelpunkt der Vorträge und Diskussionsbeiträge. Zu den Referenten gehört Dr. Regina Flake, Teamleiterin im Kompetenzzentrum Fachkräftesicherung (KOFA) am Institut der deutschen Wirtschaft Köln (IW). Sie berichtet, dass neun von zehn Unternehmen den Fachkräftemangel bereits spüren, aber nur 43 Prozent der Firmen eine langfristige Personalplanung betreiben.
WeiterlesenNachbetrachtung zur turbulenten Hauptversammlung von Siemens
Die Medien interessierten sich vor allem für die Auseinandersetzung mit den Klimaaktivisten. Nun ist Umweltaktivismus kein neues Phänomen. Spektakuläre Aktionen gegen skrupellose Walfänger, ätzende Chemiekonzerne und strahlende Atommülltransporte bilden eine lange Tradition. Dabei wurde eine Menge erreicht und das harte regulatorische Umfeld half Deutschland letztlich, zu einem führenden Lieferanten von Effizienztechnik zu werden.
Kurioserweise richtet sich der Protest aber heute ausgerechnet gegen effiziente Technik, egal ob es sich um das modernste fossile Kraftwerk Uniper oder Signaltechnik von Siemens Mobility handelt. Die Chancen stehen gut, dass der planlose Widerstand das Gegenteil des Beabsichtigten erreichen wird. Wenn Uniper keinen Strom produzieren darf, dann kommt er eben aus dem Ausland. Wenn Siemens lukrative Aufträge ausschlagen muss, dann liefert eben ein chinesischer Konkurrent – vermutlich weniger nachhaltige Technik. Gleichzeitig fallen gut bezahlte Arbeitsplätze bei Siemens und anderen Konzernen weg, wodurch die Betroffenen bestimmt nicht zu Mitstreitern der Klimabewegung werden.
Das Problem vergrößert sich noch dadurch, dass der Protest international längst nicht gleichverteilt ist. Während in Deutschland die Kämpfer gegen die Großindustrie teilweise zu Helden stilisiert werden, spielt das Thema in vielen anderen Ländern nur eine untergeordnete Rolle.
Deutsche Unternehmen werden gnadenlos in die Mangel genommen, während andere ungehindert ihr Unwesen treiben können. Es ist eine Entwicklung, die den Wirtschaftsstandort Deutschland beschädigt – oder drastischer: dem Niedergang Deutschlands als Wirtschaftsstandort weiter Vorschub leisten wird.
Foto: pixabay
Potsdamer Netzwerktag 2020
Nach der erfolgreichen Premiere des „Potsdamer Netzwerktages“ im letzten Jahr, laden auch in 2020 mehr als zehn Netzwerke zum Kennenlernen und gemeinsamen Austausch ein!
Viele Unternehmer nutzen Netzwerke, um sich gegenseitig zu unterstützen und weiterzuentwickeln. Die Vielfalt ist groß – das Spektrum reicht von regionalen Gruppen bis zu bundesweiten Organisationen, von Netzwerken, die über Weiterempfehlung mehr Umsatz generieren, unternehmerische Ideen vermitteln, sich für das Gemeinwohl engagieren oder – als Einkaufsgemeinschaft – günstige Preise für ihre Mitglieder erzielen. Nur: Welches Netzwerk passt am besten zu mir? Womit erziele ich für meine Zwecke die größten Mehrwerte?
Eine Chance, dies ohne großen Recherche-Aufwand herauszufinden und gleich mit den Akteuren der verschiedenen Netzwerke ins Gespräch zu kommen, gibt es am Abend des 20. Februar 2020 in der IHK Potsdam.
Weitere Informationen zum Ablauf des Abends und die Möglichkeit der Registrierung finden Sie unter www.potsdamer-netzwerktag.de
Neue Materialien aus dem Fraunhofer IAP
Das war das Thema für einen Vortrag, den Herr Profesor Dr. Dieter Hofmann vom Fraunhofer IAP in Potsdam am 14. Januar 2020 im Industriemuseum Teltow im Rahmen einer gemeinsamen Veranstaltung mit dem Unternehmerverband Brandenburg-Berlin gehalten hat. Das Fraunhofer-Institut für Angewandte Polymerforschung IAP ist eine Einrichtung der Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V. Das Fraunhofer IAP hat seinen Sitz in Potsdam- Golm mit Niederlassungen in Teltow, Wildau, Schwarzheide und Hamburg.
Die Forschungsbereiche sind:
Biopolymere
Die nachhaltige stoffliche Nutzung nachwachsender Rohstoffe steht im Zentrum der Polymer- Forschung des Instituts. Das betrifft sowohl natürliche, von der Natur synthetisierte Polymere , wie Cellulose, Stärkr oder Lignin, als auch biobasierte Kunststoffe wie Polylactid, deren Grundbausteine aus nachwachsenden Rohstoffen gewonnen werden. Für eine Vielzahl von Einsastzfeldern werden, oft gemeinsam mit Industriepartnern, solche Biopolymere maßgeschneidert und Verfahren zu deren Gewinnung, Verarbeitung und Veredlung optimiert oder neu entwickelt. Beispiele sind cellulosische Spinnfasern wie Viskose, biobasierte Carbonfasern, Vliesstoffe, Folien und Formkörper aus Polymermischungen mit Lignin oder Stärke. Weiterhin Verbundmaterialien mit cellulosischer Faserverstärkung, Papieradditive auf Stärkebasis oder biobasierte Klebstoffe.
Funktionale Polymersysteme
Polymere mit besonderen physikalischen und chemischen Eigenschaften werden in zunehmendem Maße als Funktionsmaterialien für Hochtechnologie-Anwendungen eingesetzt. Das Spektrum reicht von Sensoren und Aktoren, Polymeren mit halbleitenden Eigenschaften über chromogene, phototrope bis hin zu leuchtenden Polymeren, die in organischen Leuchtdioden (OLEDs) und organischer Photovoltaik eingesetzt werden.
Synthese- und Polymertechnik
Im Bereich der Synthese- und Polymertechnik ist das Institut spezialisiert auf die Synthese neuartiger Polymerstrukturen sowie auf die Entwicklung und Optimierung von Prozessen der Polymerisation. Weiterhin Arbeitsschwerpunkte sind die Herstellung von Partikeln für Werkstoffcontainer durch reaktive und nichtreaktive Verfahren sowie die Charakterisierung von Polymeren.
Life Science und Bioprozesse
In diesem Forschungsbereich werden biotechnologische Verfahren zur Entwicklung von funktionalen Proteinsystemen, kolloidalen Strukturen sowie Bio- Hybridmaterialien verwendet. Nanotechnologie und Grenzflächenchemie ergänzen die klassische Polymerforschung und fördern die Entwicklung neuer Biomaterialien, Hydrogele, bioaktive Oberflächen, Sensoren und Wirkstoffsysteme.
Pilotanlagenzentrum PAZ
Am Standort Schkopau befindet sich das Pilotanlagenzentrum des IAP. In diesem Zentrum werden Aufgaben der Technologieentwicklung und Maßstabvergrößerung von Polymersynthese und Verarbeitungsprozesse durchgeführt. Die Anlagen dienen sowohl der Entwicklung als auch der Versuchsproduktion kleiner und mittlerer Chargen.
Polymermaterialien und Composite PYCO
In diesem Forschungsbereich werden an den Standorten Teltow und Wildau Materialien aus vernetzten Kunststoffen sowie Composite aus mehreren mitenander verbundenen Materialien entwickelt. Bei dem Faser- Kunststoff- Verbund werden vor allem Kohlenstoff-, Glas-oder Naturfasern mit Kunststoff zu Materialien mit speziellen Eigenschaften verarbeitet. Diese Verbundmaterialien werden in großem Umfang in der Luftfahrt, dem Automobilbau und dem Fahrzeugbau eingesetzt.
Zentrum für angewandte Nanotechnologie CAN
Dieser Forschungsbereich am Standort Hamburg entwickelt organische Nanopartikelsysteme in Form von anorganischen Nanopartikeln und Nanocompositen und umfasst fluoreszierende, magnetische, elektrisch- und wärmeleitfähige, röntgenopake, elektrokatalytisch-aktive, metallische und keramische Nanopartikel. Die Anwendung erfolgt in den Bereichen: funktionale Materialien (Displays, LED und Beleuchtung, Solar- und Brennstoffzellen), Life Science (diagnostische Tools, Biomarker), und Home und Personal Care ( Additive für kosmetische Produkte, Wasch- und Reinigungsmittel).
In seinem Vortag behandelte Herr Professor Dr. Hofmann die Entwicklungsabläufe von den chemischen Grundlagen über die unterschiedlichen Verfahren der Veränderung der Strukturen bis zu den Prozessen der Entwicklung von Verfahren zur Produktion der neuen Materialien und ihrer Verarbeitung. Angesichts der Problematik Kunststoffe und Umwelt bilden die Entwicklungen des IAP die Grundlage dafür, immer mehr biologisch abbaubare Kunststoffe einzusetzen.
Kontakt: Prof. Dr. Dieter Hofmann dieter.hofmann@iap.fraunhofer.de
Lothar Starke